
F.A.B. auf der Terrasse seines Hauses Lille Ø in Berlin, 1937
Fritz August Breuhaus de Groot
Sich dem Phänomen Fritz August Breuhaus auf biographischer
Ebene nähern zu wollen, gleicht einer Gratwanderung. Einerseits geben
die biographischen Daten und Fakten allein kaum etwas von der
Faszination wieder, mit der Zeitgenossen und Bauherren von der
einnehmenden Persönlichkeit des Architekten berichten. Zum anderen fällt
es nicht immer leicht, die Mythen und Legenden, die Breuhaus selbst und
einige zeitgenössische Publizisten um seine Person sponnen, mit den
faktischen Spuren seiner Biographie übereinzubringen.
Wir möchten an dieser Stelle vor allem dem Adoptivsohn von F.A.B.
sehr herzlich danken, der uns in zahlreichen Interviews äußerst
bereitwillig aus seinen persönlichen Erinnerungen berichtete und so
manchen Lichtstreif ins Dunkle brachte.
Geboren wurde der Architekt Friedrich August Breuhaus - genannt "Fritz August" oder kürzer "F.A.B." - am 9. Februar 1883 im Bergischen Solingen. Sein Vater, Heinrich Hugo Breuhaus (*1859 in Oberhausen (Rhld.)), hatte sich dort im Jahr 1880 als Dentist niedergelassen und später die aus Wald bei Solingen stammende Johanne Knipping (*1858) geheiratet. Als Zahntechniker brachte es der Vater zu bürgerlichem Wohlstand, so konnte er 1890 mit seiner Familie ein eigens erbautes Wohnhaus an der Solinger Brüderstraße 49 (heute Mummstraße) beziehen und seinem Sohn von 1896 bis 1900 den Besuch einer angesehenen privaten Höheren Knabenschule in Oberkassel bei Bonn ermöglichen. Noch Tillmann Breuhaus (*1801), der Großvater Heinrich Hugos, war Tagelöhner und Ackersmann im Bergischen Leichlingen, während Heinrich Hugos Vater, Johann Friedrich Breuhaus (1831-1902), als Händler in Oberhausen (Rhld.) bereits den Aufstieg in die Kreise städtischen Bürgertums geschafft hatte.
Von "Breuhaus" zu "de Groot"
Hier offenbart sich bereits die erste Legende, die Fritz August um seine eigene Herkunft geschmiedet hat. Der Architekt, der seinem Namen etwa ab 1929 selbst den Zusatz "de Groot" verlieh, lancierte ebenfalls ab jener Zeit, er sei Enkel/ Urenkel der angesehenen holländischen Malerfamilie Breuhaus de Groot. Wenn sich auch einige Lücken im Stammbaum der Familie Breuhaus bislang nicht letztendlich haben schließen lassen, so ist heute doch klar, dass Fritz August keinesfalls Urenkel oder Enkel des in Amsterdam und Brüssel ansässigen Marinemalers Frans Arnold Breuhaus de Groot (1824-1872) war. Allerdings läßt sich die Herkunft Frans Arnold Breuhaus de Groots und des Landschaftsmalers Frans Breuhaus de Groot (1798-1875) mit einiger Wahrscheinlichkeit auf den 1769 in Höhscheid bei Solingen geborenen und gegen Ende des 18. Jahrhunderts nach Holland ausgewanderten Franz Arnold Breuhaus zurückverfolgen, womit eine weitläufige Verwandtschaft des Architekten mit dieser holländischen Linie nicht auszuschließen ist. Den nobilitierenden Namenszusatz "de Groot" hat F.A.B. zeitlebens nicht offiziell eintragen lassen.
Architekt gegen des Vaters Willen
Die Nobilitierung seines Namens fällt in eine Zeit, in der die
mythengestützte Selbstvermarktung des Architekten einen Höhepunkt
erreichte, der "natürlich" auch in Selbstauskünften über die eigene
Berufsausbildung seinen Niederschlag fand: Er habe an den Technischen
Hochschulen in Darmstadt und Stuttgart studiert, nachdem er zuvor
Schüler von Professor Peter Behrens in Düsseldorf und außerdem bei J. L.
M. Lauweriks in Holland gewesen sei, so der Lebenslauf Breuhaus' aus
jener Zeit. Tatsächlich klingt auch dieser Teil seiner Biographie
deutlich respektabler, als die heute nachweisbaren Dokumente bislang
tatsächlich rekonstruieren lassen. Sicher scheint, daß Breuhaus seine
Schulzeit in Bonn mit dem einjährigen Reifezeugnis abschloß. Im April
1900 kehrte er ins elterliche Haus in Solingen zurück, wohl um eine
Lehre beim Siegen-Solinger Gußstahl-Aktienverein anzutreten: Breuhaus
selbst berichtete verschiedentlich, er habe auf Wunsch des Vaters eine
Ausbildung zum Maschinenbauingenieur begonnen.
Von Oktober 1901 bis September 1902 war F.A.B. dann in (Wuppertal-)
Elberfeld ansässig, in diese Zeit könnte sein Besuch der Baugewerkschule
Barmen-Elberfeld fallen, ein Besuchszeugnis dieser Schule wird in den
Einschreibeunterlagen der TH Stuttgart von 1903 erwähnt. Als Grundlage
eines ordentlichen Besuchs einer Baugewerkschule galt seinerzeit
allerdings eine Lehre im Baugewerbe, die sich bislang nicht nachweisen
ließ.
Im Wintersemester 1902/03 ist Breuhaus als Hospitant der
Architekturabteilung der Großherzogl. Hessischen Technischen Hochschule
Darmstadt greifbar. Er belegte hier alle acht Vorkurse, die laut
Studienplan für das erste Studienjahr der Architektur vorgesehen waren.
In jener Zeit war auch der 1900 durch Großherzog Ernst Ludwig an die
"Künstlerkolonie Mathildenhöhe" berufene Peter Behrens in Darmstadt.
Zum Sommersemester 1903 wechselte F.A.B. als Hospitant an die Technische
Hochschule in Stuttgart. Dort belegte er bis zum Sommersemester 1904
entgegen dem vorgegebenen Studienplan vor allem Lehrveranstaltungen, die
für das zweite Studienjahr vorgesehen waren. Bis auf die Vorlesungen
zur Baukonstruktionslehre bei Prof. Conrad von Dollinger legte er mit
Wahl der Veranstaltungen Entwurf (Prof. Theodor Fischer mit Assistent
Paul Bonatz), dekorativer Entwurf (Prof. Gustav Halmhuber),
Aquarellieren (Prof. Treidler) u.a. außerdem einen deutlichen
Schwerpunkt auf gestaltende Fächer.
Breuhaus selbst berichtete über seine Studienzeit, er habe auf Wunsch
seines Vaters Maschinenbau und, seiner eigenen Neigung folgend, nebenher
Kunstgeschichte und Architektur studiert. Als sein Vater ihm wegen
Ungehorsams nach zwei Jahren die Unterstützung entzogen habe, setzte er
sein Studium nach eigener Aussage mit einer kleinen Erbschaft der
Großmutter ab 1904 an der Kunstgewerbeschule Düsseldorf fort. Es scheint
so, als folgte er damit sozusagen Peter Behrens, der 1903 zum Direktor
der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule berufen wurde. Auch Johannes
Ludovicus Mathieu Lauweriks war, berufen durch Behrens, von 1904 bis
1909 als Lehrer in Düsseldorf tätig. Breuhaus Studienzeit in Düsseldorf
kann allerdings kaum länger als vier Monate angedauert haben, da er sich
bereits im März 1905 wieder "auf Reisen" aus Düsseldorf abmeldete.
Diese Reise führte ihn allerdings nur nach Hohenasperg, vom 1.7. datiert
der Entlassungsschein der dortigen Haftanstalt. Breuhaus hatte hier
nach Verurteilung wegen eines Zweikampfs eine dreimonatige Festungshaft
abzusitzen. Die Spuren dieses Duells, Narben und Schmisse auf Wange und
Kinn, sind auch auf jüngeren Fotos noch gut zu erkennen.
Wenn man Breuhaus' Aussage, er habe nach dem Studium noch als
Angestellter und zuletzt als Atelierchef in verschiedenen
Architekturbüros gearbeitet, ernst nimmt und außerdem noch berechnet,
dass er seinerzeit auch seinen Militärdienst noch hat ableisten müssen,
dann reduziert sich die Zeit seiner Ausbildung noch weiter. Man kann den
Architekten Breuhaus' wohl mit Fug und Recht als Autodidakten
bezeichnen, einen "ordentlichen" Studienabschluß erwarb er jedenfalls
offensichtlich nie.
Frühe Jahre im Rheinland
Seinen ersten eigenen Bau plante F.A.B. bereits im Alter von 22 Jahren. Gemeinsam mit dem 1876 in München geborenen Architekten Johann Josef Kunz, genannt "Hans", betrieb Breuhaus spätestens 1906 ein Architekturbüro in Moers am Niederrhein. Eine erste Fabrikantenvilla nach Entwürfen von Breuhaus und Kunz entstand schon ab 1905 in Solingen (Rhld.), Hans Kunz hatte im selben Jahr Breuhaus' jüngere Schwester Toni geheiratet. 1907 war Breuhaus bei seinem Schwager in Bochum wohnhaft und ein Jahr ließ F.A.B. sich in Düsseldorf nieder. Aus der Moerser Zeit sind die Entwürfe zweier weiterer Villen und einer Mehrfamilienwohnhauszeile überliefert, doch erhoffte sich der junge Architekt in der Großstadt wohl bessere Erfolgschancen. Sein Vater soll ihm eine sechsmonatige Unterstützung als Starthilfe zugesagt haben, und tatsächlich konnte F.A.B. sich in Düsseldorf bald etablieren. In den folgenden Jahren war Breuhaus mit wechselnden Büropartnern verbunden, so ab etwa 1908 mit dem später in Berlin tätigen Carl Mauve und vor 1914 mit dem später in Hamburg sehr erfolgreichen Regierungsbaumeister a.D. Carl Gustav Bensel (1878-1949).
Erste Erfolge - die Gartenstadt Meererbusch

F.A.B. am Steuer seines Packard 24/120
Seinen zeitlebens andauernden Ruf als einer der prominentesten deutschen Villen- und Landhausarchitekten begründete Breuhaus mit seinen Planungen für die "Gartenstadt Meererbusch" in Büderich bei Düsseldorf. Bereits 1907 war ein erster Lageplan für diese, auf dem Grundbesitz des Freiherrn Friedrich von der Leyen nahe dem Bahnhof "Forsthaus Meer" der 1900 eingerichteten Schnellbahnlinie Düsseldorf - Krefeld errichtete Landhauskolonie entstanden. Seit spätestens 1909 war Breuhaus an der Planung der Gartenstadt wesentlich beteiligt, in den Jahren 1910/11 erbaute er hier sein erstes eigenes Familienwohnhaus, den "Eichenhof". Bis 1914 folgten mindestens ein Dutzend weiterer Landhäuser in direkter Nachbarschaft. In der um 1911 erschienenen Werbeschrift „Gartenstadt Meererbusch. Siebenhundert Morgen Waldpark. Sport- und Spielplätze. Auskunft über Landhäuser und Grundstücke sowie Verkauf von Terrain und schlüsselfertigen Bauten erteilt Architekt F. A. Breuhaus.“ trat F.A.B. gar als Generalunternehmer auf. Das Kapital für dieses ehrgeizige Unterfangen hatte Breuhaus' Ehefrau Martha (1884-1962), Tochter eines Fabrikanten und Kommerzienrates aus (Krefeld-) Uerdingen, eingebracht: Das Jahr der Heirat fällt nicht von ungefähr mit dem Einsteig Breuhaus' in die Gartenstadtplanung zusammen. Ebenfalls im Jahr 1911 erscheint die erste Werkmonographie des Architekten, ein aufwendig bebilderter und auf Büttenpapier gedruckter Prachtband, in dem F.A.B. der Öffentlichkeit voller Stolz seine aktuellen Villenplanungen in Meerbusch, Solingen und anderswo präsentiert. Den Erfolg dieser Unternehmung mag man auch daran messen, daß Breuhaus mit seinem "Eichenhof" auch gleich einen Automobilschuppen errichtete - auf die Vorzüge der angepriesenen Schnellbahn nach Düsseldorf war er selbst wohl nie angewiesen.
Private Katastrophen...
Mit Martha hatte F.A.B. vier Söhne: Der älteste, Claus (*1910),
erhielt später eine Ingenieursausbildung. Der zweite Sohn, Peter
(*1911), sollte als Architekt in die Fußstapfen des Vaters treten. 1919
kam Breuhaus dritter Sohn Jobst zur Welt. Die Geburt des jüngsten Sohnes
Michael im Jahr 1920 fällt in die Zeit nach der Scheidung der ersten
Ehe Breuhaus'. Der genaue Scheidungsgrund liegt noch im Dunklen, es ist
jedoch anzunehmen, dass die Geburt des unehelichen Sohnes Peer den
Ausschlag gegeben haben dürfte.
Zwischen 1914 und 1918 hatte Breuhaus am ersten Weltkrieg teilgenommen,
aus dem er im Range eines Feldwebels heimkehrte. Zunächst in Frankreich
stationiert, wurde er später an die Ostfront verlegt, seine
Kriegserfahrungen verarbeitete der Architekt als Dichter in dem Buch
"Der Soldat und der Tod. Gespräch in Versen.", das 1917 von einem
Tilsiter Verlag herausgegeben wurde.
Während Breuhaus' Privatleben nach seiner Rückkehr aus Russland katastrophal verlief - der dritte Sohn Jobst verstarb 1919 noch im Säuglingsalter an einer Lungenentzündung, im gleichen Jahr soll auch die Mutter seines unehelichen Sohnes Peer einer Grippe erlegen sein und 1920 erfolgte die Scheidung von seiner hochschwangeren Ehefrau Martha - konnte Breuhaus beruflich trotz brachliegender Baukonjunktur durchaus wieder Erfolge verzeichnen. So nahm er im Winter 1919 mit seinen Architekturentwürfen an einer Ausstellung in der bedeutenden Düsseldorfer Galerie Flechtheim teil, außerdem realisierte er neben Fabrikbauten für das Unternehmen seines Schwiegervaters in Uerdingen auch einige kleinere Umbauten an Landhäusern in der Gartenstadt Meererbusch.
Neuanfang in Köln
Nach der Scheidung verlegte F.A.B. Wohnsitz und Büro 1920 nach Köln,
den "Eichenhof" in Meerbusch verkaufte er 1922. In Köln ging Breuhaus
eine Partnerschaft mit dem Regierungsbaumeister Dr.-Ing. Jacob Dondorff
(*1881) ein, die Sozietät plante - typisch für jene Zeit - vor allem
genossenschaftliche Siedlungsbauten in Köln. Im Oktober 1921 ließ
Breuhaus sich in Bonn nieder, eine für den eigenen Bedarf ausgebaute
ältere Villa an der Coblenzer Straße blieb bis 1926 sein Domizil. 1922
heiratete F.A.B. ein weiteres Mal: Seine zweite Ehefrau Elisabeth geb.
Meyer (*1900) war in Barcelona geboren und aufgewachsen. Es verwundert
daher kaum, dass F.A.B. seit jener Zeit auch in Spanien Villen plant und
1922 in einer Publikation gar behauptete, ein Zweigbüro in Barcelona zu
unterhalten. Die 1923 in Bonn geborene Tochter ist heute das einzige
lebende leibliche Kind des Architekten.
Offensichtlich, um die schwache Auftragslage nach dem Krieg anzukurbeln,
veröffentlichte Breuhaus um 1921 und 1922 zwei Eigenpublikationen. Die
beiden Hefte zeigen neben einer Vielzahl bereits in der Vorkriegszeit
geplanter Landhäuser und Gutshöfe auch einige aktuelle Projekte und
jüngst realisierte Bauten. Man kann hier beinahe von einer
publizistischen Offensive des Architekten sprechen, war er doch auch
mehr denn je auch in zeitgenössischen Architekturzeitschriften
vertreten. Vor allem die Zeitschriften "Innendekoration" und "Deutsche
Kunst und Dekoration" druckten regelmäßig Artikel von und über Breuhaus
ab. Der Verleger der "Innendekoration", der Darmstädter Hofrat Dr.
Alexander Koch, publizierte auch in seiner vielbändigen Reihe
"Handbücher neuzeitlicher Wohnungskultur" zahlreiche Innenraum- und
Möbelentwürfe Breuhaus'. Der nicht erst seit der Hochphase des
Jugendstils in Darmstadt prominente Verleger war in jener Zeit der
einflußreichste Förderer des Architekten Breuhaus, beide verband
außerdem eine langjährige Freundschaft. Die Villa des Verlegers, nach
langjähriger Planung und intensiver Auseinandersetzung mit den Wünschen
des kunstsinnigen Bauherren 1926 fertiggestellt, ist Höhepunkt dieses
über Berufliches weit hinausgehenden Kontaktes. Kaum verwunderlich, dass
Verleger und Architekt diesen bemerkenswerten Bau in einer
ausführlichen Monographie - erschienen natürlich im Verlag Koch - einer
breiten Öffentlichkeit bekannt machten.
Bereits um 1922 war Breuhaus eine Partnerschaft mit dem Regierungsbaurat
a.D. Heinrich Rosskotten (1886-1972) eingegangen. Die zahlreichen
Aufträge auch für Zechen-, Industrie- und Siedlungsbauten, die die bis
1927 bestehende Sozietät aus den Kreisen der Rheinisch-Westfälischen
Montanindustrie erhielt, dürfen wohl nicht zuletzt den guten Kontakten
Rosskottens zugeschrieben werden. Beide Architekten waren außerdem
später Mitglied im Industrieclub Düsseldorf, bei dessen Treffen sich die
Wirtschaftsführer der Region die Klinke in die Hand gaben.
Kunstgewerbe als "zweites Standbein"
1923 gründete Breuhaus außerdem in Bonn die "Mikado-Werkstätten", die Textilien im Handdruckverfahren nach eigenen Entwürfen bedruckten. Breuhaus versuchte so, in Zeiten, in denen die Bautätigkeit im reparations- und inflationsbelasteten Deutschland noch immer nur langsam in Fahrt kam, neben der Architektur ein zweites Standbein als Designer zu etablieren. Wenn auch die Textildruckerei mangels Erfolgs nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wurde, so entwarf F.A.B. doch nebenbei weiterhin Möbel, Tapeten, Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (z.B. Küchenherde u.v.a.).
Der Höhepunkt seiner Tätigkeit als Designer fällt nicht von ungefähr in die Zeit der aufkommenden Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre. Als Innenarchitekt hatte Breuhaus seit jeher einen guten Namen, spätestens mit der Ausstattung der ersten Klasse des Luxusdampfers "Bremen" galt Breuhaus als Star auf diesem Gebiet. Möbel-, Textil-, Tapeten-, Lampen- und Besteckentwürfe in großer Zahl entstanden wiederum nun nicht mehr allein zur Ausstattung der von ihm geplanten Villen: Wie bereits am Anfang der Dekade verdingte F.A.B. sich mit dem Ausbleiben großer Bauaufträge zunehmend wieder als Entwerfer, so für die Vereinigten Werkstätten, den WK-Verband, die Württembergische Metallwarenfabrik WMF, die Solinger Besteckfabrik J. A. Henckels u.v.a.
Breuhaus und die "kultivierte Sachlichkeit"
Das Erscheinen einer zweisprachigen Werkmonographie in der Reihe
"Neue Werkkunst" 1929 markiert einen Höhepunkt in Breuhaus' Karriere als
Architekt und in seiner Kunst der Selbstvermarktung. Kaum ein zweiter
Band dieser Reihe vereinigt in sich eine so große und vielfältige
Auswahl an Bauten und Projekten: Neben Entwürfen und Bauten im In- und
Ausland werden zahlreiche Inneneinrichtungen, Ausstellungsgestaltungen
sowie die Ausstattungen von Passagierschiffen, Eisenbahnwaggons und der
Entwurf des Zeppelin-Luftschiffs LZ 128 vorgestellt.
Stilistisch hatte F.A.B. in jenen Jahren zu einer eigenen Form gefunden:
Seine Entwürfe verbinden sachlich-moderne Elemente des "Neuen Bauens"
mit edlen Materialien, luxuriösen Grundrissen und einer wohlabgestimmten
Farbigkeit zu höchster Eleganz. Breuhaus selbst prägte für diese
Architekturauffassung zeitgenössisch den Begriff der "kultivierten
Sachlichkeit".
Mit der Teilnahme an der von Bruno Paul geleiteten Deutschen Sektion der
Ausstellung "Mostra Internationale delle Arti Decorative di Monza" 1926
hatte F.A.B. auch international größere Beachtung gefunden.
Wie man Professor wird...
Bereits im Dezember 1928 war Breuhaus von der Bayerischen Staatsregierung der Titel eines Professors der bildenden Künste verliehen worden. Ein Blick in die Akten macht deutlich, dass Breuhaus selbst sich sehr vehement um diesen Titel bemüht hat. So stellt er seine Übersiedlung von Düsseldorf an den Starnberger See in Aussicht, meldet sich 1928 sogar offiziell im Hause seiner Eltern in Starnberg an und sichert dem Bayerischen Wirtschaftsministerium zu, für die Vergabe eines Großteils der Aufträge für die Ausstattung des Schnelldampfers Bremen an Bayerische Firmen und Künstler zu sorgen. Bei einem Gesamtauftragsvolumen von bis zu 3,5 Millionen Reichsmark fand Breuhaus unter anderem im Direktor der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Nymphenburg einflußreiche Fürsprecher. Wie sehr der Architekt die geschäftsfördernde Wirkung des Professorentitels zu schätzen wußte, zeigt sich in seinen - wenngleich erfolglosen - Bemühungen, die Verleihung des Titels noch zu beschleunigen. Die Pläne, in Feldafing ein eigenes Haus sowie eine Villenkolonie zu errichten, verliefen jedoch im Sande. Noch Ende 1929 vertröstete F.A.B. das Staatsministerium für Unterricht und Kultus, die Sache sei krankheitsbedingt ins Stocken geraten. Tatsächlich gab Breuhaus seinen Bürositz in Düsseldorf bis zu seiner Übersiedlung nach Berlin im Jahre 1932 nicht mehr auf, die ehrgeizigen Villenpläne am Starnberger See blieben unausgeführt.

Botilla, seine dritte Ehefrau, im Jahre 1933
Der Architekt als Mediengestalt
Mit Rückgriff auf den Namenszusatz entfernter Verwandter selbst zu
"Fritz August Breuhaus de Groot" quasi geadelt, geriet der überaus
charmante und gesellschaftlich sehr gewandte, frisch gebackene Professor
bald auch zum Liebling von Mode- und Publikumszeitschriften. Ein Foto
aus jener Zeit zeigt F.A.B., sehr chic im weißen Anzug mit Hut, am
Steuer seines eleganten weißen Packard-Coupés vor dem im Bau
befindlichen Dampfer "Bremen". Breuhaus selbst führt das Steuer, sein
Chauffeur hat auf dem Beifahrersitz Platz genommen. In jenen Jahren
brachte Breuhaus seine überaus wirkungsvolle Selbstinszenierung zur
Vollendung, die ihm zeitlebens einen Ruf als begnadeter Villenarchitekt,
Bonvivant, Gesellschaftslöwe und Medienstar - jedenfalls für damalige
Verhältnisse - sicherte.
Architekten waren damals wie heute selten ein dankbares Thema
glamourorientierter Modezeitschriften - anders der "legendäre" F.A.B.,
der bereits 1925 von seinem ehemaligen Mitarbeiter Hans Heinz Lüttgen
(1898-1977), wohl nicht ohne Hintersinn, als ein Erotomane der
Architektur charakterisiert wurde. Breuhaus war aber auch zu jeder Zeit
eine eindrucksvolle Erscheinung, ein gutaussehender Mann, der in
Gesellschaft charmant, smart und einfühlsam zu brillieren vermochte. Und
diese Erscheinung verfehlte wohl selten ihre Wirkung - vor allem auf
die Damenwelt, wie sich auch der Adoptivsohn Breuhaus' noch heute
erinnert.
Die Berliner Jahre

F.A.B. und Botilla, 1935
Den Höhepunkt seiner Medienpräsenz nutzte F.A.B. überaus geschickt
zum Sprung aus der Rheinischen Provinz in die Reichshauptstadt Berlin,
das unbestrittene Zentrum des deutschen Kultur- und Gesellschaftslebens.
Vorangegangen war wiederum ein privater Bruch, die Ehe mit seiner
zweiten Frau Elisabeth war 1931 geschieden worden. Auch hier darf
gemutmaßt werden, dass F.A.B.s Faszination für das schöne Geschlecht und
seine nicht zu unterschätzende Wirkung auf die Vertreterinnen desselben
nicht ganz unschuldig an der Trennung waren.
Bereits 1932 heiratete F.A.B. ein drittes Mal, seine 1895 in Rodekrug in
Nordschleswig (heute: Rødekro in Süddänemark) geborene Ehefrau Botilla
(geb. Nielsen verw. Beyer) brachte einen siebenjährigen Sohn mit in die
Ehe, den Breuhaus noch im gleichen Jahr adoptierte. Die Familie wohnte
zunächst in einer direkt am Landwehrkanal gelegenen, großzügigen
Etagenwohnung an der Königin-Augusta-Straße (heute Reichpietschufer),
die F.A.B. nach eigenen Entwürfen hatte einrichten lassen. Wie das Haus
des Fabrikanten W. in Stuttgart vermittelt diese Wohnung eine sehr
exakte Vorstellung des Breuhausschen Zeitstils, der "kultivierten
Sachlichkeit".
Es gelang Breuhaus recht bald, in Berlin gesellschaftlich Fuß zu fassen.
In seinem Gästebuch von 1931/32 finden sich illustre Namen, neben den
Künstlerkollegen Emil Orlik und Walter Trier sind unter vielen anderen
die Namen Richthofen, von Arenberg, Roechling, von Bentheim und
Steinfurt, Huldschinsky, Gerstel und viele andere zu lesen.
Die "Contempora"
Bis sich die Baukonjunktur nach der Weltwirtschaftskrise soweit
erholt hatte, dass Industrie und Privatleute wieder bauen konnten, hielt
sich Breuhaus wieder einmal mit kunstgewerblichen Entwürfen über
Wasser, außerdem gründete er 1932 die private Kunstgewerbeschule
"Contempora - Lehrateliers für neue Werkkunst". Der Name ist
offensichtlich an Lucian Bernhards (1883-1972) New Yorker Atelier für
Werbegraphik und Innenarchitektur angelehnt. Ihre Räume bezog die Schule
in dem Haus in der Emser Straße, in dem auch Breuhaus' Architekturbüro
residierte. Während F.A.B. als Leiter der Schule auch Raumkunst und
Textilentwurf lehrte, stellte er u.a. den Maler und Graphiker Otto Arpke
(1886-1943) als Lehrer für Mode- und Gebrauchsgraphik ein, Erich Balg
unterrichtete im Bereich Fotographie, Werbung und Reportage, der seit
1930 im Atelier Breuhaus' tätige junge Architekt Cäsar F. Pinnau
(1906-1988) Innenarchitektur. Eine der berühmtesten Schülerinnen der
Privatschule war Elisabeth Noelle (*1916), die spätere Leiterin des
Instituts für Demoskopie in Allensbach.
Breuhaus' Adoptivsohn weiß noch heute zu berichten, dass böse Zungen
einst das Gerücht streuten, F.A.B. habe die Schule nur gegründet, um
leichteren Zugang zu jungen Damen zu haben. Tatsächlich stellte die
Kunstschule mindestens eine willkommene Einnahmequelle dar, bis um 1934
die Zahl der Bauaufträge wieder merklich zunahm.
Die "kleine Insel"
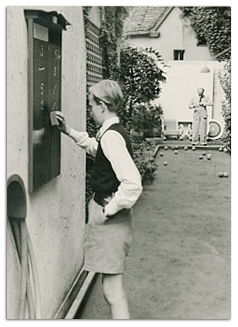
Boccia mit seinem Adoptivsohn am Haus Lille Ø
Das Haus "Lille Ø" (Dänisch für: kleine Insel), das F.A.B. für sich und seine Familie 1934 auf einem aus dem Grundbesitz der Familie Wertheim ausparzellierten Grundstück in Schmargendorf errichtete, gehört zu den herausragendsten Bauten im Werk Breuhaus' und formuliert geradezu programmatisch die Breuhausschen Thesen von ebenso sachlichem wie kultiviertem Wohnen, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg das Werk des Architekten weiterhin prägen sollten. Zu F.A.B.s Prominenz wird dieser seinerzeit vielbeachtete Bau, der dreiseitig einen intimen Gartenhof umschließt, nicht unerheblich beigetragen haben, bis Ende der 1930er Jahre errichtete Breuhaus in den westlichen Berliner Villenvororten mindestens 50 kleinere und größere Einfamilienhäuser, Landhäuser und Villen. Zu seinen Kunden jener Zeit zählten Freiberufler ebenso wie Direktoren und Industrielle, Adelige und Prominente aus dem Kulturleben. Einen wichtigen Aspekt im Werk Breuhaus bringt sein Adoptivsohn auf den Punkt: Breuhaus habe niemals einen Entwurfsauftrag angenommen, wenn der Bauherr seine antiken Möbel in das neue Haus übernehmen wollte. F.A.B. sei für seine hohen Standards bekannt gewesen, er habe ein Haus immer mitsamt einer ganz auf den Bauherren zugeschnittenen Einrichtung, sozusagen als "Gesamtkunstwerk", entworfen - oder eben gar nicht.
Nicht allein Häuser...
Neben großen und kleineren Einfamilienhäusern prägen vor allem zwei
bemerkenswerte Werkgruppen das Schaffen Breuhaus' in der ersten Hälfte
der Dreißiger Jahre: Dass F.A.B. noch vor 1933 mit dem Entwurf der
Ausstattungen für mehr als ein Dutzend Schiffe - darunter vor allem
Kriegs- und Schulschiffe der wiederaufrüstenden deutschen Marine -
erhielt, muss wohl als eine Folge seiner hochgelobten zivilen
Schiffsausstattungen gesehen werden. Vergleichbar in seiner Rolle als
"Schiffsarchitekt" ist Breuhaus mit einem Zeitgenossen, dem bei Theodor
Fischer in München ausgebildeten italienischen Architekten Gustavo
Pulitzer-Finali (1887-1967), der in den 1920er und 1930er Jahren in
Triest die Ausstattungen von über zwanzig Passagier- und
Schlachtschiffen entwarf.
Eine deutlich kleinere, aber nicht weniger bemerkenswerte Werkgruppe
bilden Breuhaus Ausstattungsentwürfe für Flugzeuge, so ein Postflugzeug
der Deutschen Lufthansa und das Dienstflugzeug des
Reichsluftfahrtministers Hermann Göring. Vielversprechend erscheint hier
ein Vergleich mit F.A.B.s Berliner Architektenkollegen Otto Firle
(1889-1966), der bereits 1918 das Kranich-Signet der späteren Lufthansa
und in den 1930er Jahren außerdem auch Flugzeugausstattungen entworfen
hat sowie mit den amerikanischen Architekten Henry Dreyfuss (1904-1972),
Norman Bel Geddes (1893-1958) und dem Designer Raymond Loewy
(1893-1986), die zeitgleich für US-Airlines entwarfen.
Der Ruf in die Türkei

Der Dandy in den Alpen, 1934
In den frühen Dreißiger Jahren erhielt Breuhaus außerdem große
Planungsaufträge in der Türkei. Bereits 1925 hatte die Türkischen
Nationalversammlung den Beschluss zum Bau staatlicher Zuckerfabriken
gefaßt, am 5.12.1933 wurde die Türkiye Seker Fabrikalari A.S. im
anatolischen Eskisehir eröffnet, am 19.10.1934 folgte eine weitere
Anlage in Turhal. F.A.B. plante neben den Fabrikanlagen auch die
Verwaltungsgebäude an beiden Standorten sowie jeweils zugehörige
Arbeitersiedlungen mit Direktorenvillen, Casinos, Krankenhäusern und
weiterer Infrastruktur. 1934 errang er außerdem am Wettbewerb um ein
Bankhaus der 1933 gegründeten Sümerbank in Ankara einen ersten Preis,
der Auftrag ging jedoch an den Münchener Architekten Martin Elsaesser.
Voller Stolz publizierte Breuhaus mehrfach, er habe in Edirne einen
Palast für Mustafa Kemal Atatürk, den Begründer und ersten Präsidenten
der Republik Türkei, erbaut. Die Ausführung dieses ehrgeizigen Planes,
der außerdem auch eine städtebauliche Neuordnung der historischen Stadt
Adrianopel umfasste, konnte jedoch bislang nicht nachgewiesen werden.
1936 war auch F.A.B. für die Nachfolge Hans Poelzigs (1869-1936), der
noch vor Übernahme des Lehrstuhls für Architektur an der Kunstakademie
Istanbul verstorben war, im Gespräch. Berlins ehemaliger Stadtbaurat
Martin Wagner (1885-1957), der auch Poelzig vorgeschlagen hatte, konnte
jedoch, selbst seit 1935 als Lehrer in Istanbul tätig, die Berufung des
1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nach Japan
emigirierten Bruno Taut (1880-1938) durchsetzen.
Zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erwog F.A.B. ein zweites
Mal, an die Akademie in Istanbul zu gehen. So fragte er bei Paul Bonatz
(1877-1956), selbst 1946 bis 1953 Professor in Istanbul, an, ob man mit
dem dort zu erwartenden Einkommen "einen gewissen, nicht zu kleinen
Lebensstandard (...) mit Auto" aufrecht erhalten könne. Bonatz erwiderte
brüskiert, nur der habe verdient, in dieses Paradies zu kommen, der es
um der Aufgabe wegen täte.
F.A.B. und der Nationalsozialismus

Zarah Leander in "ihrem" Haus Lille Ø in Berlin, nach 1941
Doch zurück in die Dreißiger Jahre: Nach der Erinnerung seines
Adoptivsohnes geriet Breuhaus ab 1935 zunehmend in Opposition zum
herrschenden Nazi-Regime. F.A.B.s Ehefrau Botilla soll in jenen Jahren
außerdem jüdischen Familien zur Flucht aus Deutschland verholfen haben,
was ein hochrangiger Vertreter des Staates Israel dem Adoptivsohn noch
1953 bestätigt habe.
Unter F.A.B.s heute bekannten Projekten nach 1935 finden sich dennoch
einige, die direkt oder indirekt von Staats- oder Parteistellen in
Auftrag gegeben worden waren, so der bis Kriegsbeginn bearbeitete
Ausführungsentwurf einer Deutschen Botschaft in Washington D.C. nach
Wettbewerbserfolg von 1937, der Wettbewerbsentwurf eines Gauforums in
Frankfurt (Oder) 1937-38, der Entwurf einer Kaiserlich Japanischen
Botschaft in Berlin um 1938, die Beteiligung am Wettbewerb von 1938 um
eine "UFA-Filmstadt" in Babelsberg bei Potsdam, die Planung eines
Botschafterpalais' in Sofia vor 1940 sowie 1939-40 der
Wettbewerbsentwurf der Fassade eines Verwaltungsgebäudes für das
Reichsversicherungsamt an der Berliner Nord-Süd-Achse im Rahmen der
Speerschen "Germania"-Planungen.
Im Jahr 1941 sprach Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, so der
Adoptivsohn, ein spezifisches Berufsverbot gegen F.A.B. aus und
beschlagnahmte persönlich dessen Haus "Lille Ø" zur Unterbringung der
Sängerin und Schauspielerin Zarah Leander, des höchstbezahlten Filmstars
im Dritten Reich. Eine zeitgenössische Aufnahme zeigt die Leander "ganz
privat" im Innenhof des Hauses Breuhaus', der Architekt siedelte mit
seiner Familie nachweislich zum 1. April 1941 in den Flecken Garitz bei
Bad Kissingen über.
Von den örtlichen Parteibonzen argwöhnisch überwacht, war der vitale
Architekt zu beruflicher Untätigkeit verdammt und versuchte sich in
Ölmalerei, die, wie er selbst in einem Interview in den frühen 1950er
Jahren zugab, wenig bemerkenswert blieb. Die einzigen "Bauprojekte"
jener Zeit blieben ein Schuppen für Schweine, Hühner und Kaninchen im
Garten des Garitzer Landsitzes - die Tiere sicherten der Familie das
Überleben über das Kriegsende hinaus.
Besonders hart traf die Familie in jenen Jahren auch der Tod der drei
ältesten Söhne F.A.B.s, Claus, Peter und Michael: Sie alle fielen im
Laufe von nur drei Jahren an der Ostfront.
Auch Breuhaus private Kunstschule "Contempora" war 1941 unter
fadenscheinigen Gründen geschlossen und in die staatliche Hochschule für
bildende Künste Berlin eingegliedert worden, Breuhaus ehemaliger
Büroleiter und Assistent an der Schule, Cäsar F. Pinnau, wurde ein Jahr
später durch die Verleihung eines Professorentitels geehrt. Pinnau hatte
ab 1937 an Entwurf und Inneneinrichtung zahlreicher hochrangiger
Staatsbauprojekte, so Hitlers "Neuer Reichskanzlei" in Berlin,
federführend mitgewirkt.
Rückkehr ins Rheinland
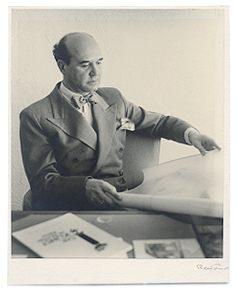
F.A.B. in seinem Kölner Büro, nach 1950
Breuhaus blieb auch nach Kriegsende zunächst in Bad Kissingen
ansässig. Ab 1947/48 konnte der Architekt mit Villen- und
Landhausplanungen im Rheinland und in Westfalen wieder an seine 1941
unterbrochene Karriere anknüpfen. 1950 eröffnete er ein Büro in der
Kölner Altstadt, er selbst zog mit seiner Frau Botilla erst 1952 wieder
ins Rheinland.
Bereits 1950 hatte F.A.B. erste Pläne für ein eigenes Wohnhaus in Bad
Honnef-Rhöndorf zur Genehmigung eingereicht, erst nach zahlreichen
Änderungen und Dispensen bezog das Ehepaar Breuhaus im Jahr 1952 an
Botillas Geburtstag das neue Heim. Die Wohnhalle öffnet sich über ein -
natürlich elektrisch betriebenes - Panoramafenster zum Hanggarten
oberhalb des Rheintals. Der Name "Lille Brøndegaard" (Dänisch für:
kleiner Brunnengarten) weist auf einen innerhalb des Hauses gelegenen
kleinen Gartenhof hin. Auf der seitlich angeordneten Bocciabahn
entspannte sich F.A.B. - wie bereits in seinen Berliner Jahren - am
frühen Abend gerne mit Gästen oder Freunden.
Das Haus liegt nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Wohnsitz Konrad
Adenauers entfernt. Mündlich ist überliefert, dass Breuhaus durchaus
Kontakt zum ersten Kanzler der jungen Bundesrepublik suchte, andere
Geschichten berichten jedoch auch, dass der knorrige und bodenständige
Kanzler seinem ungewöhnlichen Nachbarn gegenüber stets mehr als
reserviert blieb.
Der "kleine Brunnengarten"
"Lille Brøndegaard" zeigt beispielhaft, wie Breuhaus seine Idee des
"kultiviert sachlichen" Wohnens, den veränderten Bedingungen und
Ansprüchen der Nachkriegszeit angemessen, neu interpretierte. Im Zentrum
des Hauses stand noch immer der sehr großzügig bemessene Wohnraum, der
durch bodentiefe Fenster beinahe nahtlos in eine weitläufige Terrasse
übergeht. Allerdings diente dieser mit Kaminecke, Arbeitsplatz,
Bücherwand und Barfach ausgestattete Raum nun gleichermaßen privaten wie
repräsentativen Zwecken: Hier konnte man ebenso gut Empfänge mit
mehreren Dutzend Gästen veranstalten, wie die tägliche Arbeit und das
Familienleben hier ihren Platz fanden. Dem Wohnbereich seitlich
zugeordnet, der für Breuhaus so typische kreisrunde Speiseraum, der
Platz für Diners mit bis zu 12 Personen bot. Die übrigen Räume, zwei
Schlafzimmer mit Ankleide und Bad, der Flur, Küche und Anrichte (sowie
ein Chauffeursraum neben der Garage und eine Mädchenkammer im Keller)
waren zwar von eher bescheidener Größe, wirken aber noch heute dank
ihrer durchdachten Ausstattung, Möblierung und Beleuchtung durchaus
großzügig und freundlich.
Das zur Straße hin völlig uneinsehbare eingeschossige Haus zeigt sich
zum Garten hin außergewöhnlich modern: Das Flachdach oberhalb der
Wohnhalle dient als Dachterrasse. Diese kragt, getragen durch eine
schlichte Pilzstütze, in weitem Halbrund über die Hauptterrasse aus und
bildet so einen überdachten Freisitz mit einem zweiten Kamin. Sehr
zeittypisch ist auch der dynamische Schwung der Wendeltreppe, die,
angelehnt an den Außenkamin, zur Dachterrasse hinaufführt.
F.A.B. - Ein moderner Eklektizist
Kurz nach Bezug seines Rhöndorfer Hauses gab F.A.B. einer Sonntagsillustrierten ein bemerkenswertes Interview, in dem der Architekt sich als ein später Anhänger einer - wenn auch gemäßigten - Moderne präsentiert: So wird berichtet, seine Karriere habe erst 1928 begonnen, als er das erste Mal so bauen konnte, wie er es sich in langen Jahren vorgestellt habe. Weiterhin wird er mit den Worten zitiert:
"Aber wenn ich heute so bauen würde, wie in zehn Jahren gebaut werden wird oder wie ich gern bauen möchte - dann bekäme ich nicht einen einzigen Auftrag. Heute würde man die Bauten der Zukunft primitiv nennen. Aber Einfachheit und Zweckmäßigkeit haben nichts mit Primitivität zu tun! Die Wohnhäuser der Zukunft müssen ein Paradies für die Hausfrau werden. Denn die Hausfrau ist ein schlecht bezahlter Schwerarbeiter. Frauen wissen auch, was schön, praktisch und bequem ist. (...) Ein Architekt muß ein Psychologe sein: er muß auf den Bauherrn eingehen. Außerdem soll das Haus in die Landschaft passen. Ich habe keinen eigenen Stil entwickelt, denn Landschaft und die Wünsche des Bauherren regen mich zu vielen immer neuen Gedanken an".
Selbstauskünfte eines "Architekten für morgen"

Hieronymus Tatzelwurm, der Bobtail
Der Behauptung im gleichen Artikel, F.A.B. habe seit 1928 über 400
Häuser aller Arten erbaut, wird noch nachzugehen sein; die Zahl aller
heute bekannten Bauten und Entwürfe seit 1905 übersteigt allerdings
bereits die Zahl 450. Nicht ganz wahrheitsgemäß erscheint allerdings
F.A.B.s Aussage, er habe für sich selbst bereits vierzehn Häuser erbaut.
So lassen sich zwar durchaus ein gutes Dutzend Wohnadressen Breuhaus'
bis 1952 ausmachen, doch handelt es sich bei dem größten Teil
keinesfalls um Neubauten, in den meisten Fällen lediglich um kleinere
Umbauten und Inneneinrichtungen älterer Häuser.
Die Sonntagsillustrierte gewährt ihren Leserinnen auch einen "intimen"
Einblick in die Lebens- und Arbeitsgewohnheiten des "Architekten für
morgen": So zeigen die Fotos F.A.B. im Morgenmantel beim Frühstück und
mit Ehefrau Botilla am Arbeitstisch über Pläne gebeugt, im Vordergrund
die Perserkatze Maja und der Pudel Penny:
"Die Idee für ein Haus läßt mich nicht
schlafen. Morgens um vier Uhr stehe ich auf und fange an zu zeichnen und
zu entwerfen. Ein Joghurt ist mein erstes Frühstück. Und Zigaretten
gehören zur Arbeit. Außerdem brauche ich Ruhe und eine gepflegte
Umgebung. Deshalb entwerfe ich selten im Büro; meist arbeite ich zu
Hause. (...)"
"Oft beginnt es so: Der Bauherr zeichnet das gewünschte Haus auf eine
Serviette! Nun muß der Architekt umformen und ins Baugelände. (...)"
"Ich zeichne übrigens ohne Reißbrett, nur auf Millimeterpapier, aus
freier Hand. Das Reißbrett zwingt zu rechtwinkligen Formen. Ich bin ein
Gegner jeder Symmetrie. Keine starren Formen: das ist mein Prinzip. Ich
lebe gern gut und bequem, das muß man wohl als Architekt, wenn man für
andere schöne Wohnhäuser bauen soll. Mein Beruf füllt meine ganze Zeit
aus. (...)"
"Meine Frau prüft sehr kritisch meine Entwürfe. Sie hilft, die Wünsche
der Bauherren zu ergründen und gibt Ratschläge. Ich baue nicht nur
Häuser. Auch Treppengeländer, Türen und Lampen habe ich entworfen und
Möbelstücke, Vasen, Geschirr, Zigarettenbehälter, Bestecke - alles, was
dazu gehört. Es gibt keine Nebensächlichkeiten in einem gepflegten Haus.
Ich habe auch schon Romane geschrieben und Bilder gemalt. Die Romane
waren miserabel! Von den Bildern behauptet es meine Frau auch."
Botilla Breuhaus - Sonne und Schatten

F.A.B. und Botilla, 1955
An eine enge - auch die Arbeit einschließende - Verbindung von F.A.B.
und dessen "Tilla" genannter Ehefrau erinnert sich auch der
Adoptivsohn. Sie sei nicht nur als Gastgeberin zahlloser Dinnerpartys
geradezu legendär gewesen und habe darüber hinaus ihrem Gatten nicht nur
beratend assistiert, sondern auch selbst Entwürfe für
Einrichtungsgegenstände gezeichnet. Nach Breuhaus' Tod habe sie das Büro
- unter anderem mit F.A.B.s letztem Teilhaber Artur Gérard -
weitergeführt und außerdem bis zu ihrem Tod im Jahre 1988 in
Zusammenarbeit mit einem bekannten Kölner Einrichtungshaus noch
zahlreiche Inneneinrichtungen im In- und Ausland realisiert.
Trotz der zeitlebens anhaltenden Faszination Breuhaus' für das "schöne
Geschlecht" blieb das Paar bis zum Tod des Architekten zusammen - der
Adoptivsohn zitiert seine Mutter zu diesem wohl nicht konfliktfreien
Thema mit den Worten: "Wo viel Sonne - da viel Schatten".
Die letzten Jahre im Hahnwald
Nach einer kurzen Zwischenstation in einer Mietwohnung in
Köln-Lindenthal bezog das Paar um 1956 mit dem Haus "Tre Brønde"
(Dänisch für: Drei Brunnen) das letzte eigene Wohnhaus im Kölner
Prominentenvorort Hahnwald. Das auffallend dekorativ gestaltete moderne
Landhaus gehört zu den größten Häusern, die Breuhaus je für sich selbst
geplant hat.
Dass Breuhaus in den 1950er Jahren durchaus wieder an seine Erfolge der
Vorkriegszeit anknüpfen konnte, verraten auch die drei Bildbände, die
der Architekt 1953, 1957 und 1961, den letzten also bereits nach seinem
Tode, herausgab. Neben seinen eigenen Häusern in Rhöndorf und Hahnwald
zeigen die Bände einen breiten Querschnitt aus F.A.B.s Schaffen in der
Zeit des Wirtschaftswunders: Landhäuser und Villen im In- und Ausland
nehmen nach wie vor den größten Raum ein. Mehr denn je zuvor werden aber
auch Verwaltungsgebäude und Geschäftshäuser sowie die Ausstattungen von
Geschäften, Restaurants und Hotels vorgestellt. Der Kreis der Bauherren
jener Schaffensphase, soweit bislang nachvollziehbar, ist vor allem
unter den Spitzen des Kölner Wirtschafts- und Gesellschaftsleben zu
suchen.
F.A.B. und der amerikanische Traum
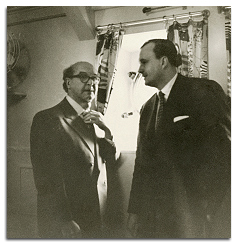
Abschied von seinem Adoptivsohn, der in die USA übersiedelte, 1956
Obwohl Breuhaus zeitlebens auch im europäischen Ausland, im Nahen
Osten und in Mittel- und Südamerika plante und baute und so zeitweise
auch international Aufmerksamkeit errang, blieb er doch zeitlebens in
Deutschland ansässig. Gleichwohl war F.A.B. fasziniert von den
Vereinigten Staaten, die er unter anderem anläßlich der Jungfernfahrt
der "Bremen" bereiste. Breuhaus' Adoptivsohn, der 1956 in die USA
auswanderte und dort eine bemerkenswerte Karriere als Investmentbänker
machte, nachdem er im Nachkriegsdeutschland zunächst für die US-Army und
später für einen amerikanischen Automobilkonzern tätig war, begriff
erst bei seinem Abschied in Rotterdam, wie tief dieser Wunsch seines
Vaters ging: "Tränen rollten über seine Wangen und er sagte zu mir: Ich
weiß, wie schwer dies für dich sein wird - ich beneide dich, du kannst
in das Land gehen, wo ich immer leben wollte." Dass F.A.B. diesen
Schritt, selbst während der NS-Zeit, als Botilla die Emigration
jüdischer Freunde nach Kalifornien arrangierte, nicht gewagt habe, sei
wohl vor allem auf Breuhaus' mangelnde Sprachbegabung zurückzuführen.
Dabei habe selbst der große amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright
(1869-1959) noch in den frühen Fünfziger Jahren versucht, F.A.B. zu
einem Treffen in San Francisco einzuladen: Er habe sich immer gefragt,
warum Breuhaus' Bauherren höhere Honorare zu akzeptieren bereit waren,
als die seinen. Und Breuhaus hatte schon in den Zwanziger Jahren mit
Stolz schreiben können: "Ich liquidiere nicht nach Gebührenordnung"...




